Der Erfolgsautor will’s wissen und schickt einen neuen Serienhelden auf die Bühne: Johann Friedrich von Allmen, einen schnöseligen Bonvivant, der seit Jahren chronisch pleite ist und mit seinem ehemaligen Diener, einem treuen Guatemalteken, im Gartenhäuschen seiner ehemaligen Villa lebt. Die repräsentative Adresse ist ihm ebenso wichtig wie der schöne Schein, den er unter großen Mühen aufrecht erhält, kleine Gaunereien inklusve. Das klingt alles ganz nett und liest sich – wie könnte es bei Suter anders sein – auch locker weg.
Aber irgendwie fehlt da etwas. Die Personen, die in diesem ersten Fall
„Allmen und die Libellen“ auftreten, sind eher grob skizziert,
Scherenschnitte ohne Fleisch und Blut, auch wenn Suter der nymphomanen
Tochter aus reichem Haus, die Allmen auf ganz neue Gedanken bringt,
durchaus körperliche Präsenz zugesteht. Jedenfalls kapituliert der arme
Allmen vor ihrem sexuellen Heißhunger und lädt sie in ein stinkfeines
Restaurant, das ihn beinahe den letzten Groschen kostet. Da ist es nur
recht und billig, dass er sich anderweitig bedient. Als er in einem Raum
der Seevilla eine Vitrine mit Jugendstilschalen von Emil Galle,
Libellen genannt, findet, entwendet er ohne große Skrupel eine davon und
macht sie bei seinem verschwiegenen Antiquitätenhändler zu Bargeld.
Dass der Händler kurz darauf einem Mord zum Opfer fällt, bringt Allmen
um einen weiteren erhofften Zusatzverdienst und auf die Spur eines
früheren Versicherungsdiebstahls. So wird der Dieb zum Ermittler.
Das war’s dann schon – fast. Ein paar überraschende Wendungen hat Suter
doch noch auf Lager. Und, wer weiß, vielleicht bekommt Allmen das
nächste Mal einen wirklich spannenden Fall. So einen wie Kommissar
Maigret, den Allmen so gerne liest. Doch um dessen Format zu erreichen,
muss Suter seinen Serienhelden noch ordentlich aufmöbeln.
Info: Martin Suter, Allmen und die Libellen, Diogenes, 200 S., 18,90 Euro
Warning: Undefined variable $content in /var/www/www_lilos-reisen_de/www/wp-content/themes/Hercules-theme/includes/post-formats/standard.php on line 67
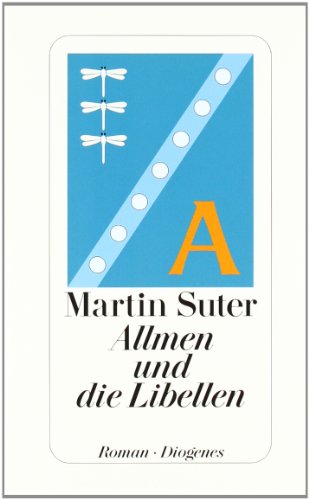



lilo
Grazyna Kotlubei
lilo
Wolfgang Jandl
Max